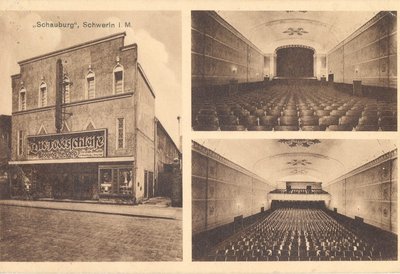Hausgeschichten PR-Anzeige
Vom Domherrenhof zum Haus der Denkmalpflege

Wer kennt das nicht: Da steht ein schönes Haus in der Straße, hundertmal und mehr ist man schon vorbeigegangen. Aber was verbirgt sich hinter der Fassade? Welche Geschichten stecken hinter den Mauern, wer geht hier ein und aus? Denn schließlich sind Geschichten von Häusern immer auch Geschichten von Menschen. In dieser Serie wollen wir gemeinsam mit Ihnen hinter Fassaden blicken. Heute im Domhof, wo eines der ältesten Baudenkmale Schwerins das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege beherbergt.
Wenn Achim Bötefür an seinem Schreibtisch sitzt, ist der Barock zum Greifen nah. Der Mitarbeiter im Landesamt für Kultur und Denkmalpfl ege hat seinen Arbeitsplatz in einem Gebäude des Domhofs, das um 1680 entstand. Kleine Spuren deuten in dem zweckmässig eingerichteten Büro auf die einst aufwändige Ausstattung hin. Neben der sanierten Stuckdecke ist ein Balken gleich neben dem Schreibtisch besonders interessant: Er zeigt Reste einer illusionistischen Malerei, die den Eindruck einer umrankten Säule vermitteln soll. Balken aus dem späten 17. Jahrhundert - die sind nicht von gestern. Noch älter ist der so genannte Renaissancefl ügel des Domhofs, an den der Barockbau angefügt wurde. „O Herr erbarme di unser unde wes uns gnedich“ steht auf einem Balken dieses Gebäudeteils, das laut Inschrift im Jahr 1574 entstand. Damit galt der Domhof lange als ältester erhaltener Profanbau Schwerins. Inzwischen trägt diesen Titel eines der Nachbarhäuser in der Puschkinstrasse 36.
„Hier ist mit Hilfe dendrochronologischer Untersuchungen das Alter auf 1572 datiert worden“, sagt Dirk Handorf, Mitarbeiter des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege. Da derartige Untersuchungen im alten Stadtkern bisher selten sind, sind weitere Uäberraschungen moäglich. „Baugrundstück“ war der Domhof jedenfalls lange vor 1574. Im 13. Jahrhundert befand sich hier zuerst der bischoäfl iche Obstgarten, doch bereits 1267 schenkte Bischof Hermann I. von Schwerin das Land dem Schweriner Domkapitel zur Errichtung eines Domherrenhofes. 300 Jahre später folgte die Säkularisierung: Joachim von Halberstadt, Grundherr von Klein Brütz, kaufte das Grundstück mit den Kuriengebäuden. Er liess den Renaissancebau zuerst als Wirtschaftsgebäude errichten, später, um 1630, wurde er jedoch zu Wohnzwecken umgebaut. Aus dieser Zeit stammt eine prächtige Kassettendecke im ersten Obergeschoss, zur Burgstrasse hin wurde ein Turm angefügt. „Er wird manchmal irrtümlich als Turm der Stadtmauer bezeichnet, beherbergt aber nur das Treppenhaus des Gebäudes“, erklärt Dirk Handorf.
In den folgenden Jahrhunderten war der Domhof Gasthof und Armenküche, Polizeikommissariat und Arbeitsamt und beherbergte ab 1952 unter anderem die Tierzuchtinspektion, die Grosshandelsgesellschaft Obst und Gemüse und den Schulbuchverkauf des Volksbuchhandels. Interessant ist das Angebot von Vergnügungen auf dem ehemaligen Kirchenland. Im 19. Jahrhunderts erhielt der Barockteil einen Anbau, der neben einem Tanzsaal auch Spielsäle beherbergte. Die Sanierung des alten Domhofensembles begann bereits 1983 - allerdings sehr schleppend. In der Wendezeit kamen die Arbeiten dann ganz zum Erliegen und erst 1996 konnte das Landesamt für Denkmalpfl ege einziehen.
„Natürlich gibt es in einem solchen Haus keine geraden langen Flure, von denen die Türen abgehen. Da geht es schon mal treppauf, treppab und der Zuschnitt der Räume ist unterschiedlich“, sagt Dirk Handorf. Das macht dieses Bürogebäude besonders reizvoll. Die denkmalgerechte Sanierung war natürlich ein Muss - schliesslich sitzen in dem Haus Mecklenburg-Vorpommerns hauptamtliche Denkmalpfleger.