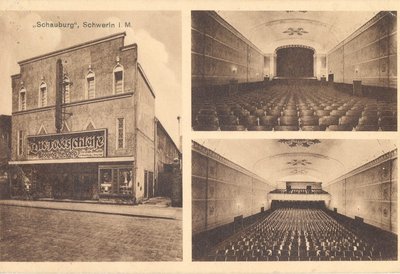Hausgeschichten PR-Anzeige
MITTEN IN DER STADT

Wer kennt das nicht: Da steht ein schönes Haus in der Straße, hundertmal und mehr ist man schon vorbeigegangen. Aber was verbirgt sich hinter der Fassade? Welche Geschichten stecken hinter den Mauern, wer geht hier ein und aus? Denn schließlich sind Geschichten von Häusern immer auch Geschichten von Menschen. In dieser Serie wollen wir gemeinsam mit Ihnen hinter Fassaden blicken. Heute im Hof der Landesrabbiner-Holdheim-Straße, wo mit der neuen Synagoge ein Stück Schweriner Geschichte fortgeschrieben wird.
Vorbeigehen sollte man an der Schweriner Synagoge wirklich nicht. Zwar steht sie etwas versteckt im Hof der Landesrabbiner-Holdheim-Straße gleich neben dem Schlachtermarkt. Aber viele Schweriner wollen auch gar nicht vorbei-, sondern hineingehen: Das Interesse an dem Bauwerk ist riesengroß. „Wir haben mindestens einmal in der Woche eine Führung“, freut sich der Verwaltungsleiter der jüdischen Gemeinde, Valeriy Bunimov. Es kommen Gruppen von Kindern, Jugendlichen und Senioren, aus der Stadt und aus dem Umland. Sie alle sind neugierig auf das Bauwerk – und auf das jüdische Leben, das seit 1994 in Schwerin neu erwacht ist.
Das sichtbarste Symbol dafür ist die Synagoge. Sie steht genau dort, wo sich bis 1938 das Versammlungs- und Gotteshaus der jüdischen Gemeinde Schwerin befand. In der Pogromnacht vom 9. November plünderten und zerstörten Nationalsozialisten das Gebäude. Sie steckten es nur deshalb nicht in Brand, weil sie ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Wohnhäuser fürchteten. Stattdessen mussten Mitglieder der jüdischen Gemeinde ihre Synagoge selbst abtragen.
Fundamente und Fußbodenfliesen dieses Baus entdeckten Archäologen, als 2008, 70 Jahre später, der Bau der neuen Schweriner Synagoge begann. Wer heute den Gebetsraum betritt, passiert diesen Sockel aus alten Feldsteinen, der unter einer Glasplatte wie in einem „Zeitfenster“ sichtbar wird. An der Wand des Foyers sind weitere Erinnerungen zu sehen: der Gedenkstein, der 1951 am einstigen Standort gesetzt worden war, eine Abbildung des Innern der Schweriner Synagoge um 1880 und Fragmente einer Tafel mit hebräischer Inschrift, welche die jüdische Gemeinde 1884 anlässlich des ersten Todestages von Großherzog Friedrich Franz II. stiftete.
So entsteht an dem historischen Platz eine Verbindung zwischen alter und neuer Gemeinde, wird der Geist des Ortes neu geweckt. Neu auch in der Art des Baus und der Ausstattung: Zeigt die Abbildung von 1880 noch einen prunkvollen, reich ausgestatteten Raum, besticht die neue Synagoge mit ihrer Schlichtheit. Schon bei der Außenhülle des vom Schweriner Architekten Joachim Brenncke entworfenen Baus dominieren klare Linien: Das im Grundriss fast quadratische Gebäude wirkt erdverbunden und stark und scheint gleichzeitig durch seine leicht geneigte Ostwand gen Himmel zu streben. Drei Fenster in Form des Davidsterns sind nach außen hin die einzigen Zeichen der sakralen Bestimmung des modernen Backsteinhauses. Diese Fenster liefern auch eine von vielen Anekdoten, die Valeriy Bunimov zu dem Bau erzählen kann. „Wir hatten uns in der Gemeinde bunte Scheiben vorgestellt. Aber unser Rabbiner sagte: Die Fenster müssen einfach sein, damit der Blick auf den Toraschrein an der Ostwand fällt und durch nichts abgelenkt wird“, erinnert er sich und fügt hinzu: „Das waren weise Worte, denen wir gern folgten.“
Der Toraschrein aus hellem Holz bewahrt die Torarollen, die nur während des Gottesdienstes herausgenommen werden. Aus hellem Holz sind auch die Sitzbänke – neben dem Schrein die einzigen Einrichtungsgegenstände in dem hellen, schlichten Raum. Hier haben mehr als 100 Menschen Platz – nach den Provisorien vergangener Jahre für die Gemeinde ein wahres Geschenk. Denn in der Vergangenheit fanden Gottesdienste in einem kleinen Gebetsraum statt, in den nur 35 Personen passten. An hohen Feiertagen wie Jom Kippur reichte dieser Platz nie aus, sogar im Vorraum drängten sich dann die Gläubigen.
Heute kann die jüdische Gemeinde würdige Gottesdienste feiern. Männer und Frauen sitzen dabei Seite an Seite, die einen links und die anderen rechts.
Eine Frauenempore, wie sie in orthodoxen Gemeinden wegen der verlangten räumlichen Trennung von Männern und Frauen während des Gottesdienstes üblich ist, gibt es in Schwerin nicht. „Unsere Gemeinde ist modern-traditionell“, sagt Valeriy Bunimow und zitiert damit Landesrabbiner William Wolff.
Traditionen bewahren und sich gleichzeitig Neuem öffnen – diesem Grundsatz zeigt auch die Synagoge. Und apropos öffnen: Nicht nur interessierten Gruppen (bitte vorher anmelden!), sondern auch für kulturelle Veranstaltungen öffnen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde gern ihre Tür.