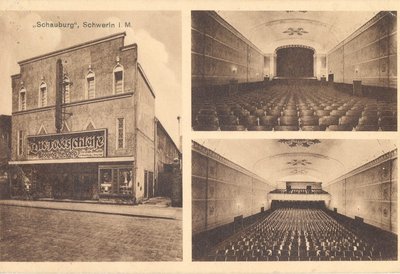Hausgeschichten PR-Anzeige
Betreten erwünscht

Wer kennt das nicht: Da steht ein schönes Haus in der Straße, hundertmal und mehr ist man schon vorbeigegangen. Aber was verbirgt sich hinter der Fassade? Welche Geschichten stecken hinter den Mauern, wer geht hier ein und aus? Denn schließlich sind Geschichten von Häusern immer auch Geschichten von Menschen. In dieser Serie wollen wir gemeinsam mit Ihnen hinter Fassaden blicken. Heute da, wo das Betreten ausdrücklich erwünscht ist: im Freilichtmuseum Schwerin-Mueß.
Die Hauswände sind in freundlichem Weiß getüncht, die Balken in Ochsenblutrot und obenauf thront ein neues Reetdach. Regelrecht romantisch wirkt der alte Hirtenkaten auf dem Gelände des Freilichtmuseums in Schwerin-Mueß. „Darin zu leben war allerdings alles andere als traumhaft“, weiß Volker Janke, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums. Vor 200 Jahren, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, teilten sich zwei Familien den kleinen Katen: die des Kuhhirten und die des Schweinehirten. Lediglich zwei niedrige Kammern standen jeder Familie zur Verfügung - alles in allem rund 40 Quadratmeter für 16 Personen. Auf der Diele wurde gearbeitet, die Ställe wiederum waren den wertvollen Tieren vorbehalten. Allerdings nur den Rindern - die Schweine hielten die Hirten wegen des Geruchs doch lieber in einem separaten Gebäudeteil.
An der Rückseite der Diele sind heute zwei Kochstellen rekonstruiert, an denen früher die beiden Hausfrauen - Rücken an Rücken - das Essen zubereiteten. „Bei dieser Enge kann ich mir schon vorstellen, dass auch mal die Kochlöffel flogen“, sagt Volker Janke. Er kennt sogar Überlieferungen, die von weißen Strichen erzählen, welche in Häusern gezogen wurden, um die eigene Fläche von der fremden abzugrenzen. Die räumliche Enge war der Sparsamkeit geschuldet. Hirten, die oft nur für eine Saison angestellt waren, gehörten zum untersten bäuerlichen Stand. „Deshalb spielte das Wort ,wohnen‘ in einem Haus wie diesem keine Rolle, es wurde entweder gearbeitet oder geschlafen“, erklärt Janke. Auch die Raumtemperatur machte den Hirtenkaten im Winter nicht unbedingt anheimelnd: Auf der Diele mit ihren beiden Feuerstellen war es ungefähr fünf Grad wärmer als draußen. „Quellen erzählen, dass in kalten Wintern auf den Bettdecken eine Eisschicht lag“, schmunzelt Volker Janke. Kirschkernkissen und am Feuer gewärmte Feldsteine waren das Rezept der Menschen gegen die Kälte.
Noch heute sind in dem Haus viele Spuren der einstigen Bewohner zu finden. Da ist die Rille in der Schwelle zum Stall, die vom täglichen Gebrauch einer Schubkarre ohne Luftbereifung erzählt. Da sind die geschwärzten Deckenbohlen, die an das einstige Rauchhaus erinnern. Hier hängte man Wurst und Schinken unter die Decke, so dass der nach oben steigende Rauch das Fleisch einnebelte und haltbar machte. Einen Schornstein gab es nicht. „Der eigentlich lästige Rauch bot viele Vorteile: Er konservierte neben den Räucherwaren auch das Getreide, das im Haus lagerte, und hielt Ungeziefer und Holzwürmer fern“, erklärt Ethnologe Janke. Sogar die Redewendung „ins Fettnäpfchen treten“ stammt aus einem Rauchhaus: Unter den an der Decke hängenden Räucherwaren stellten die Bewohner Gefäße auf, um das herabtropfende Fett aufzufangen. Wer dort hinein trat, verdarb es sich mit der Hausfrau, die das Fett natürlich wie jedes andere Produkt der Landwirtschaft im Haushalt verwerten musste. Und so vermeidet es noch heute jeder gern, ins Fettnäpfchen zu treten - wenn auch nur im übertragenen Sinne.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Zeit der Rauchhäuser vorbei. Es wurde eine Feuerverordnung erlassen, die jeder Feuerstelle einen Schornstein vorschrieb, um so die Schilfdächer vor Funkenflug zu schützen. Trotz dieser Modernisierung blieb das Leben der Menschen auf dem Lande noch lange sehr einfach. Von diesem Leben erzählen neben dem Hirtenkaten auch die anderen Gebäude des Mueßer Freilichtmuseums, das deshalb etwas Besonderes ist, weil die alten Gebäude hier an ihren originalen Standorten erhalten sind.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Noch bis zum 23. August ist die Ausstellung „Vom Maulbeerblatt zum Seidenkleid“ zu sehen. Besondere Attraktion sind lebendige Seidenspinner, die auf ihrem Weg vom mohnsamengroßen Ei bis zum Kokon betrachtet werden können.